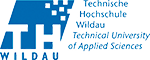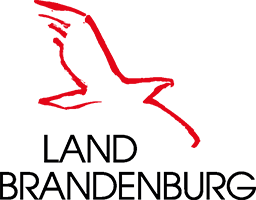Spektrale 11 / Teilnehmer
Susken Rosenthal
 Susken Rosenthal
Susken Rosenthal
Brück, OT Baitz
VITA
- 1977 – 86 Kunststudium an der UdK Berlin und Accademia die Belle Arti Florenz
- 1986 Meisterschülerin (UdK Berlin, bei Prof. Wolfgang Petrick)
- 1987 – 88 Post Graduate Stipendium am California Institute of Arts, Los Angeles (Studium Bühnenbild)
- 1994 Arbeitsstipendium des Landes Brandenburg
- seit 1995 künstlerische Leiterin von Kunstpflug e.V.
- 1996 Arbeitsstipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg
- 1997 Förderpreis für Bildende Kunst des Landes Brandenburg
- 2001 1. Platz für den Entwurf zur Gestaltung der Ländervertretung von Brandenburg am Potsdamer Platz, Berlin
- 2004 – 06 Lehrauftrag an der Fachhochschule für Gestaltung, Dessau
- 2010 Aufenthaltsstipendium, Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf, Land Brandenburg
- 2012 – 19 Aufenthaltsstipendien in Finnland, in Kosice K.A.I.R., Slowakei, Kamiyama Artist Residency, Japan, Valdobbiadene, Italien und Bortolomiol SPA,
- 2015 Förderpreis für Bildende Kunst des Landes Brandenburg
 Patience (Auslegung, Solitaire)
Patience (Auslegung, Solitaire)
Patience ist ein Kartenspiel, das meist von einer Person gespielt wird. Im Deutschen wird Patience allgemein mit Geduld übersetzt. Über diese bewundernswerte Eigenschaft verfügt Susken Rosenthal ganz offensichtlich. Angelehnt an die „Kleine Harfe“ hat sie eine Entsprechung von sechs quadratischen Bodenplatten auf den von Schotter gerahmten Beton vor Halle 14 gelegt, die mit ihren unterschiedlichen Mustern Verbindungen zwischen Kulturen und Kunst, Wissenschaft und Mathematik, Klima und Natur assoziiert. Für die einzelnen Bereiche dieser 18 Meter langen und sechs Meter breiten Bodenarbeit, bestehend aus jeweils sechs zersägten und ausgelegten Sperrmüllplatten und besetzt mit Fundstücken, die allesamt aus der Gegend um Belzig stammen und von Rosenthal recycelt wurden, verweist einerseits auf den sorgsamen Umgang mit knapper werdenden Ressourcen und offenbart andererseits Susken Rosenthals Neigung zur Ästhetik des Ornaments. hs

Anna Arnskötter
 Anna Arnskötter
Anna Arnskötter
Lentzke
VITA
- 1961 in Greven/Westfalen geboren, lebt und arbeitet in Lentzke, Brandenburg
- 1980 – 1984 Studium der Bildhauerei an der Freien Akademie Nürtingen,
- 1993 Kunsthochschule Weissensee, Berlin
- 1995 3. Bildhauerinnen Symposium, Prösitz
- 1998 Internationaler Schneeskulpturenwettbewerb Nuuk, Grönland
- 2000 Förderpreis der Darmstädter Sezession
- 2002 Stipendium Sommeratelier Kunstverein Greven
- 2003 Translokationen, Architektur der Nomaden, Symposium, Potsdam
- 2006 2. Preisträger Kreiselkunstwettbewerb Greven
- seit 2012 Mitglied bei Xylon, Deutschland
- 2014 Realisierung einer Bank aus Beton für Fehrbellin
- 2021 Realisierung einer 6,20 m hohen Keramik-Skulptur für den Emsdeich Greven
 Chateau d´eau
Chateau d´eau
„Wasser ist das kostbare Gut, das Grundlage von allem Leben ist.“
Baulich betrachtet, gleicht Anna Arnskötters Skulptur „Wasserschloss“ aus hochgebrannter rotbrauner Keramik eher den im historischen Stil seit Mitte des 19. Jahrhunderts errichteten, die Skyline der Städte prägenden Wassertürmen. Aus vier runden Bauelementen aufgebaut und zusammengesetzt, erscheinen in umgekehrter Weise zwei verbundene, konisch zu- bzw. weglaufende Körper, deren abgeflachte Kegelspitzen in der Mitte fest verbunden sind. Die Turmfassade selbst ist mit einem regelmäßigen Raster kleiner quadratischer Öffnungen versehen, aus denen jederzeit dosiert Wasser treten könnte, was zum Sinnbild , zum Verweis und Appell wird, mit der existenziellen Ressource Wasser sorgsam und solidarisch umzugehen. Den Abschluss bildet ein ebenso den historischen Vorbildern nachempfundener umlaufender Mauerwerksgürtel, der einem mit gleichförmigen Lochmuster versehenen Arkadenring gleicht. Auf dem Boden um den Turm sind Schalen aus weißem Porzellan in loser Anordnung aufgestellt. Diese einfachen und archaischen Gefäße verweisen auf den individuellen Verbrauch des Wassers als Grundnahrungsmittel. hs

Christian Henkel
 Christian Henkel
Christian Henkel
Berlin und Finsterwalde
VITA
- *1976 in Rudolstadt, lebt und arbeitet in Berlin
- 1997 – 2000 Ausbildung zum Holzschnitzer
- 2000 – 2006 Studium der Bildhauerei und Installation an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden in der Klasse von Prof. Monika Brandmeier, Dresden
- 2006 – 2008 Masterstudent bei M. Brandmeier
- 2008 – 2010 Arbeitsaufenthalt in Amsterdam/NL
- seit 2013 Lehrauftrag an der Hochschule für Bildende Künste Dresden
- seit 2018 Gastprofessor an der Hochschule für Bildende Künste Dresden
A sculpture is a painting is a building
In einer Malerei, die alles Kleinliche ausschließt, vertraut Christian Henkel stets auf die Ausdruckswerte von Linie, Farbe und Form, auch wenn Letztere sich erkennbarer Vertrautheit entzieht. Mit der Hinwendung zu städtischen Räumen und urbaner Atmosphäre entwickelte er zudem eine Bildsprache, die aus der Verklammerung von Architektur, Natur und Figur erwächst. Zwischen deckend oder transparent, einer reich abgestuften tonigen Modulationen und subtil verlaufenden Farbfeldern kommt es wiederholt zu fragmentarischen Andeutungen von Chiffren gegenwärtigen Bauens, deren fließende Übergänge, Übermalungen und sichtbare Überdeckungen durch lineare Verspannungen rhythmisiert werden. Dabei entstehen ebenso unbestimmte wie unbestimmbare Räume, die als Ort zukünftiger Behausung oder der Verlorenheit darin in Frage kommen. Im attraktiven Dialog der Farben vertraut Henkel qualitätvollen Wandfarben und hochpigmentierten Silikatfarben der Firma Keim, die sich durch besondere Brillanz auszeichnen und Langlebigkeit über den Zeitraum der Spektrale 11 hinaus garantieren. hs

Helge Leiberg
 Helge Leiberg
Helge Leiberg
Oderbruch, Berlin
VITA
-
* 1964 in Dresden-Loschwitz, Lehre als Positiv-Retuscheur
-
1973-1978 Studium an der Hochschule für bildende Künste in Dresden bei Gerhard Kettner
-
1984 Ausreise nach Berlin (West)
-
1990 Gründung der Performance-Gruppe GOKAN mit der Tänzerin Fine Kwiatkowski und den Musikern Lothar Fiedler und Dietmar Diesner
-
seit 1994 verstärkte Beschäftigung mit plastischen Arbeiten
-
2005 Teilnahme an der Kunstbiennale in Beijing und 2015 an der Biennale in Venedig
-
2013 Brandenburgischer Kunstpreis für Malerei
-
2022 Preis für sein Lebenswerk
-
lebt und arbeitet im Berlin und im Oderbruch
 Entfesselung der Kräfte
Entfesselung der Kräfte
Seit Jahrzehnten lotet Helge Leiberg die Möglichkeiten des Gegenständlichen im Spannungsgefüge der Moderne aus. Dabei wahrt er stets die Balance zwischen Figuration und Abstraktion. Heftige Pinselschläge, ungewöhnliche Körperhaltungen, extreme Perspektiven und funky colors stehen als Kennung für ein malerisch-zeichnerisches Werk, in dem kontinuierlich nach universeller Zeichenhaftigkeit für zeitlos menschliche Grundsituationen gestrebt wird. So auch im großformatigen Bild „Entfesselung der Kräfte“ mit seiner unglaublichen Motivdichte, in dem die verknappten Figuren in ihrem ausuferndem Bewegungsdrang auf engstem Raum zu emotional bewegten Zeichen werden, die scheinbar Einblicke in ihr oder unser aller Unterbewusstsein gewähren bzw. sich als Botschaftsträger verselbständigen. Helge Leiberg, der Selbstgenügsamkeit in der Kunst wie im Leben ausschließt, hat in Kontinuität ein bleibend starkes Interesse an allem Körperlichen und Seelischen, an den menschlichen Begierden, an Aggressionen, Ängsten und Sehnsüchten entwickelt, was in Summe zugleich als alarmierender Ausdruck einer labilen Welt im Umbruch erscheint. hs

Anna Grunemann
 Anna Grunemann
Anna Grunemann
Jamlitz
VITA
-
*1969, verheiratet, zwei Kinder (*1997, *1998)
-
1987 – 1991 Studium Lehramt Mathematik/Kunsterziehung in Erfurt, Diplom/1. Staatsexamen
-
1991 – 1999 Studium der Freien Kunst a. d. FH-Kunst und Design in Hannover
-
2000 Abschluss als Meisterschülerin bei Ulrich Baehr, Studienschwerpunkte: Kunst im öffentlichen Raum, Film / Video, Dokumentarfilm, Objekte und Rauminstallationen,
Seitdem Ausstellungsbeteiligungen und Performances im In- und Ausland
° 2010 Jahresstipendium des Landes Niedersachsen
° 2018 Rückkehr ins Land Brandenburg
° 2019 Gründung brandung e.V. – Verein zur Förderung von Kunst und Kultur in der Region Dahme-Spree-Neiße
Weitere Arbeitsfelder: Kunstvermittlung (u.a. Kunstverein Hannover (2000-2019), Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover (seit 2013 Kunst umgehen-Jahresprogramm zur Kunst im öffentlichen Raum), Kuration von Ausstellungen im öffentlichen Raum / seit 2020 im öffentlichen ländlichen Raum
Rhizomatische Territorialstruktur
Den ursprünglich aus der Botanik stammenden Begriff des Rhizoms erfährt in Anna Grunemanns „Rhizomatischer Territorialstruktur“ eine Neubestimmung mit Blick auf das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Mensch. In Gestalt eines mehrfach in sich verbundenen röhrenartigen Systems aus Carbonstangen und Edelstahl, das die an zentraler Stelle des Campus verortete Science Box in ihrer strengen Architektur verfremdend überzieht, werden neue Ordnungsstrukturen geschaffen, die bestehende Systeme hinterfragen und Möglichkeiten, neue zu schaffen, provozieren sollen. Gerade in Zeiten territorialer Machtverschiebungen sollen für Besucher die vom Dach ausgehenden und im Boden „wurzelnden“ Röhren zu einer Vermittlungsstelle zwischen wissenschaftlicher Theorie, Kulturwissenschaften und Gesellschaftspolitik werden. Entstanden ist eine ästhetisch anspruchsvolle Raumzeichnung, eine ortsbezogene Installation, die sich, denkt man an Carbon und die Anwendung in der Gesundheitsvorsorge, oder die Forschungsarbeit zur Künstlichen Intelligenz, auch auf die wissenschaftliche Arbeit an der TH Wildau bezieht. Chancen und Risiken inklusive. hs

Matthias Zinn
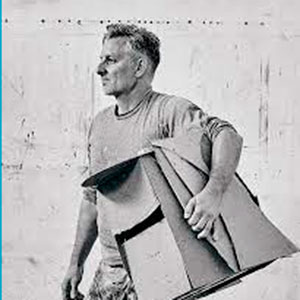 Matthias Zinn
Matthias Zinn
Kremmen
VITA
-
* 1964 Tegernsee bei München, lebt und arbeitet als Maler und Bildhauer in Berlin und Kremmen bei Oranienburg
-
1972 Umzug nach Hamburg
-
1984 – 1986 Studium der Architektur an der Technischen Universität Lübeck
-
1987-1993 Studium der Malerei an der Hochschule der Künste (UDK Berlin).
-
Die Bilderserien seiner Köpfe und Frauen sowie seine skulpturalen Arbeiten spiegeln unseren eigenen Übergangszustand in der heutigen Welt: Gesichter werden dekonstruiert und scheinen eine neue Identität zu schaffen. Körper scheinen sich in viele Realitäten aufzuspalten oder fragile, instabile Positionen einzunehmen. Ergänzt werden diese Arbeiten durch Zinns jüngste Serie „Trees“, in der der Künstler Eingriffe in die Natur vornimmt, die sich im Laufe seines Arbeitsprozesses zu einem Kampf zwischen wachsender Form und technischer Struktur entwickeln. Direktor der Galerien und Museen der Stadt Cham
Tree
Der Baum von Matthias Zinn auf der Wiese irritiert. Dabei erscheint das Nützliche und Technoide in der bebauten Umgebung nicht als nur fremd, weil es notwendigerweise mit der Industriearchitektur in Verbindung steht. Auf dem kultivierten Rasen einer begradigten und begrenzten „Mini-Natur“ innerhalb eines von weitgehend nüchterner Zweckarchitektur bestimmten technischen Ortes, greifen auf provozierende Weise Kunst und Natur, Geformtes und Ungeformtes ineinander, wodurch ein Sinnbild eines künstlerisch geformten Stückes Natur im Übergang entsteht. Nach innen und nach außen gerichtete Kurvatur nimmt die kühle Strenge und Starrheit der Linien und verhilft der asymmetrischen Zweiteilung zur harmonischen und lebendigen Erscheinung. Die Gestaltung der technischen Version des Baumes basiert auf einer Freihandskizze, deren abstrahierte Natur-Formen laserbasiert aus Aluminium geschnitten zum assoziierenden Objekt installiert wurden, das sich als intervenierender Fremdkörper im Spannungsfeld zwischen Backsteinbauten und Laubbäumen auf einem schwarz gestrichenen Podest aus Fichtenholz in der Landschaft behauptet. hs
Andreas Theurer
 Andreas Theurer
Andreas Theurer
Berlin und Mittenwalde
VITA
-
*1956 in Göppingen
-
1977 – 1983 Bildhauerstudium bei Alfred Hrdlicka, Kunstakademie Stuttgart
-
1982 Studienreise durch die Sowjetunion, Japan und China
-
1983 – 1988 Assistent an der TU Braunschweig am Institut für Elementares Formen
-
1989 – 1993 Freiberuflich tätig in Berlin, Lehrbeauftragter an der Universität der Künste
-
1993 Berufung an die Hochschule Anhalt in Dessau
-
1995 Dekan im Fachbereich Design der Hochschule Anhalt
-
2002 – 2003 Gast-Dozent an der Kabul University, Faculty of Fine Arts
-
2004 Gründungsmitglied bei Sculpture Network
-
2009 Aufnahme in den Deutschen Künstlerbund
-
2016 Mitglied im Kuratorium der Georg-Kolbe-Stiftung
 Höhenflüge und Hirngespinste
Höhenflüge und Hirngespinste
Im Titel Spektrale steckt der lateinische Begriff Spektrum, in seiner Bedeutung für Bild, Erscheinung, Gespenst stehend. Erscheinungen, die sich häufig in nebelhaft durchsichtiger, angedeutet menschlicher oder nicht menschlicher Gestalt als Träger von Höhenflügen und Hirngespinsten zeigen. Andreas Theurer: „Mein Projekt steht für das Entdecken, für die Wissenschaft, für geistige Höhenflüge, das Vernetzen und Verbinden, das Erweitern unserer Vorstellungskraft, das Verwandeln von Gewöhnlichem in Außergewöhnliches und nicht zuletzt für den homo ludens, der seine Fähigkeiten spielerisch entwickelt und entdeckt“ (A. Theurer). In diesem geistigen Bild- und Wortzusammenhang soll der ehemalige Wasserturm, der seine ursprüngliche Funktion und Bedeutung verloren hat, zum Schauplatz der Verwandlung werden.
Die den Turm erklimmenden Figuren bestehen aus schwarzen, zugeschnittenen Gewebeplanen mit Ösen, die durch Seile und Bänder verknüpft und verspannt sind. Andreas Theurer bedient hierbei nicht die archaische Vorstellung, die Silhouette könne als detailgetreues Abbild die Erinnerung an einen Menschen lebendig halten, der sich an geistigen Höhenflügen versucht. Silhouetten können genauso gut und stellvertretend für die Anonymität der in der NS-Zeit hier zwangsweise Beschäftigten aus besetzten Ländern Europas gelten, wie es die angrenzende Gedenkstätte als Erinnerungsort nahelegt. at/hs

Jay Gard
 Jay Gard
Jay Gard
Berlin
VITA
- *1984 in Halle (Saale), aufgewachsen in Karl-Marx-Stadt
- 2002 nach dem Abitur einige Semester Malerei und Grafik an der Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein in Halle (Saale)
- 2006-08 Arbeit in New York für den US-amerikanischen Künstler Tom Sachs und in Berlin für den deutschen Künstler Thomas Demand.
- 2008-11 Fortsetzung des Studiums an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in Leipzig in der Klasse für Installation und Raum bei Joachim Blank fort.
- 2010 Gründung des Labels VEGA-Leipzig, für das er unterschiedliche Audio-Objekte entwarf und umsetzte, seit 2012 lebt und arbeitet er in Berlin
 Schnörkel
Schnörkel
Auch wenn Jay Gard bevorzugt formale Anregungen am Ort seines vorübergehenden Wirkens aufnimmt, weist die geradezu spielerisch offene, asymmetrische Form, die nach dem Aufstreben zu ihrem Ausgangspunkt zurückfindet, keine körperhafte Anmutungen auf. Das freistehend konzipierte Werk entspricht seinen inneren und in diesem Fall gegenstandsunabhängigen Formvorstellungen. Es assoziiert eine Endlosschleife, die in leuchtendem Rot aus der kompakten Form des grauen Sockels erwächst und keinen Anspruch auf Interpretation erhebt, sondern als eine Art kalligrafisches Zeichen für sich selbst steht. Mit den eher dem Irregulären folgenden leichten Biegungen oder kräftigen Rundungen kommt Bewegung in die Gleichförmigkeit des plastischen Bandes, das steigt und in Kurven fällt, das den Spannungsbogen zwischen konstruktiver Statik und lebendiger Bewegung füllt. Dank der unprätentiösen, in ihrer Einfachheit bestechenden Form, wird sowohl sinnlicher als auch intellektueller Genuss provoziert. hs

Ilka Raupach
 Ilka Raupach
Ilka Raupach
Schwielowsee, OT Caputh
VITA
- *1976 in Hennigsdorf
- 1996 – 2000 Ausbildung zur Elfenbeinschnitzerin und Meisterin in Michelstadt
- 2000 – 2005 Studium Kunst/Freie Bildhauerei an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle und Kunsthochschule in Bergen, Norwegen, Diplomabschluss sowie Uummannaq und Ilulissat, Grönland
- 2009-2019 künstl./wiss. Mitarbeiterin am Institut für Architekturbezogene Kunst der TU Braunschweig
- seit 2023 Vertretungs-Professorin an der Hochschule Wismar, Fachbereich Gestaltung
- Mitglied BBK Brandenburg, GEDOK Brandenburg, sculpture network, VG Bild-Kunst, KSK

Schneefeld
Nach dem Prinzip des All-over bedecken biomorphe, an Zellen oder Blütenblätter erinnernde Formen aus textilem Material die einheitlich organisierte, reliefartige Bildfläche, die den Eindruck erweckt, nach allen Seiten hin unbegrenzt fortgesetzt werden zu können. Was hat es mit diesem textilen Schneefeld auf sich? Und wer war Alfred Lothar Wegener? Wer Ilka Raupach kennt, weiß um ihr stark ausgeprägtes Umweltbewusstsein, um ihr Engagement für Klimaschutz und ihre Vorliebe für skandinavische Winter mit reichlich Schnee und Eis. Die Antwort auf die Frage nach der Person lautet: Alfred Lothar Wegener (*1880 in Berlin, †1930 auf Grönland) war ein Brandenburger Meteorologe sowie Polar- und Geowissenschaftler. Auf der Grönlanddurchquerung im Jahr 1913 führte er erste Eisbohrungen auf einem bewegten Gletscher in der Arktis durch, um Informationen über das Klima der Vergangenheit der Erde zu erhalten. Mit ihrem Schneefeld begibt sich Ilka Raupach auf Wegeners Spuren, in dem sie ein 160 x 800 cm textiles Gebilde in der Bibliothek installiert, das aus Kettfaden und Gebrauchttextilien gewebt ist und im übertragenen Sinn symbolhaft für Verdichtung, Schmelze, Vereisung, Konservierung steht. hs

Tomasz Lewandowski
 Tomasz Lewandowski
Tomasz Lewandowski
Görlitz
VITA
-
*1978 in Nysa (PL)
-
2004 Abschluss als Ingenieur an der Technischen Universität Oppeln (PL)
-
2006 Mitbegründer der TUMW Breslau (PL),
-
2007 Miteigentümer und später Journalist der Zeitschrift Inwestor (PL)
-
seit 2010 freiberuflicher Journalist und Fotograf für Architekturzeitschriften
-
2012 Master of Arts – Abschluss in Fotografie an der Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle (Saale) bei Prof. Rudolf Schäfer
-
2012 Lehrbeauftragter an der Burg Giebichenstein U.o.A.
-
2014 Beginn der Promotion im Fachbereich Design Studies
-
seit 2014 Gastdozent für Fotografie am Institut für Kunstpädagogik Warschau und an der Burg Giebichenstein – Universität der Künste Halle
-
2018 Gastdozent für Fotografie in der Martin-Luther-Universität Halle (Saale) ,
-
2022 Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh)
Made in Germany
Der Fotograf Tomasz Lewandowski widmet sich seit Längerem dem brisanten Thema Zwangsarbeit in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Nach dem Überfall auf Polen begann die Leidensgeschichte von 13,5 Millionen verschleppter Frauen und Männer, die zur Sklavenarbeit in der Industrie, der Rüstungsproduktion, auf Baustellen, bei der Reichsbahn und in der Landwirtschaft sowie in privaten Haushalten benutzt wurden. Auch in Wildau wurden während des Zweiten Weltkrieges in den Betrieben des Schwermaschinenbaus bis zu 10.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter beschäftigt. Im Rahmen der Dokumentation „Made in Germany“ werden Erzeugnisse deutscher Industrie aus der Zeit von 1939 bis 1945 fotografisch analysiert. Dabei handelt es sich um Fabrikate von Unternehmen, die sich aktiv an dem nationalsozialistischen Programm der Zwangsarbeit beteiligt haben. Die ausgewählten Objekte werden nüchtern-präzise in Szene gesetzt. Das Sklavensystem des Dritten Reiches wird damit indirekt, anhand der Ästhetik seiner wirtschaftlichen Artefakte untersucht. Diese Methode verspricht einen Beitrag zur Erinnerungskultur von einer neuen Qualität, indem sie den Bezug zur Gegenwart herstellt. tl/hs
Die Entstehung dieses Werkes wurde durch ein Stipendium der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ermöglicht.